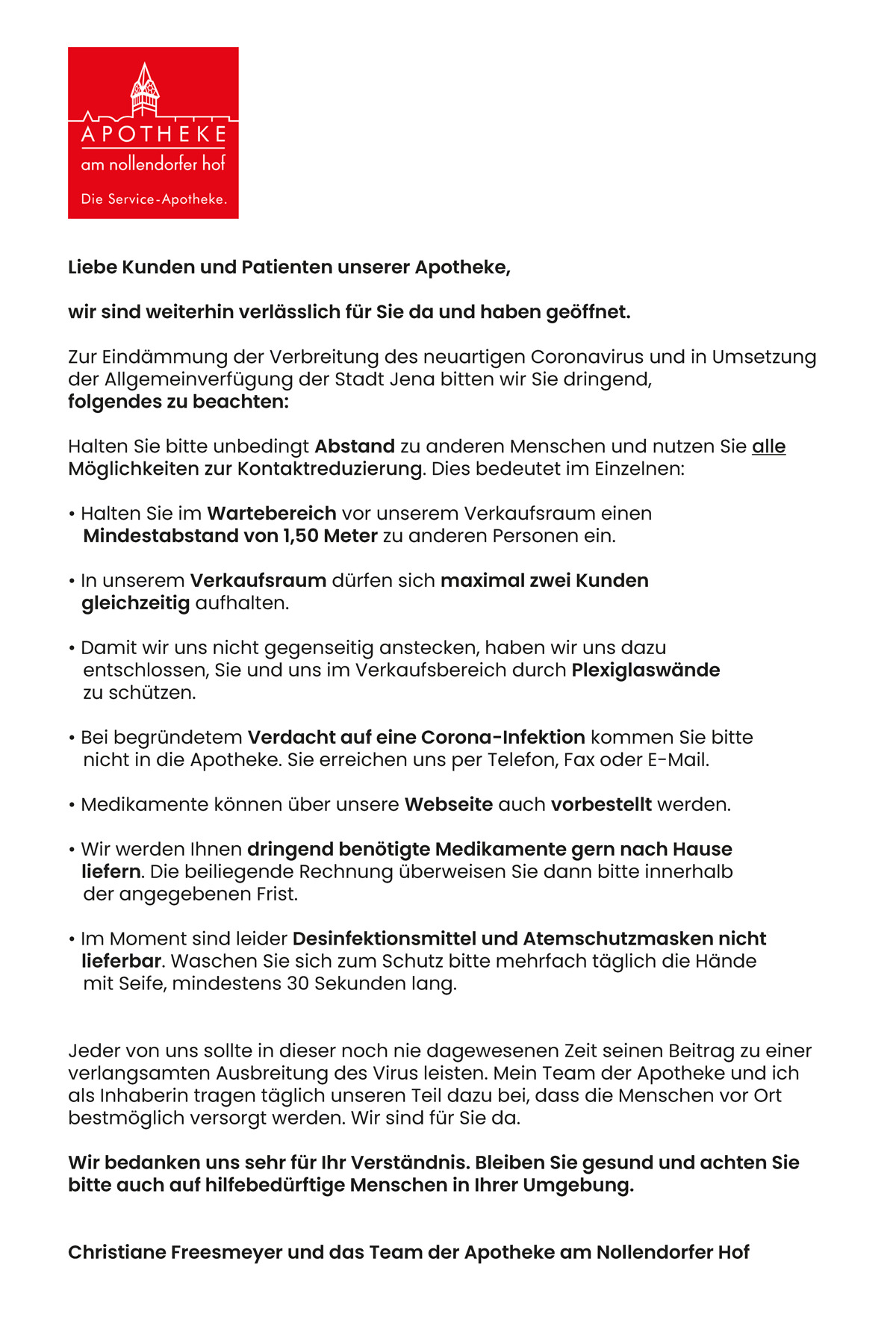In den heißen Sommermonaten, wenn die Temperaturen über die 30-Grad-Marke klettern, ist es besonders wichtig, gut auf sich selbst und andere zu achten. Denn an solchen Tagen ist der Körper intensiv damit beschäftigt, nicht zu überhitzen.
Bei hohen Temperaturen schwitzen wir stärker, weil der Schweiß den Körper von außen kühlt. Dies führt jedoch auch zu einem erheblichen Flüssigkeitsverlust, der an sehr heißen Tagen bis zu zwei Liter betragen kann.
Durch das viele Schwitzen wird zudem der Salzhaushalt im Körper gestört. Wer dann nicht ausreichend trinkt und sich zu lange in der prallen Sonne aufhält, kann die Folgen deutlich zu spüren bekommen. Hier ein Überblick über Hitzenotfälle und die richtigen Maßnahmen: